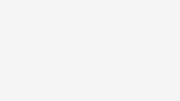Ein nicht gehaltener Vortrag von Ursula Birsl, Delegiertenversammlung der SPD Göttingen
18. Januar 2018
Vorbemerkung: Der Orkan „Friederike“ hat verhindert, diesen Vortrag auf der offenen Delegiertenversammlung des Stadtverbandes Göttingen zu halten, weil ich nicht nach Göttingen kommen konnte. Deshalb habe ich ihn hier nun aufgeschrieben. Ich verzichte dabei darauf, noch einmal auf die Sondierungsergebnisse im Einzelnen einzugehen. Die wichtigen Argumente gegen und für Koalitionsverhandlungen sind auf der DV des Stadtverbandes Göttingen und der Mitgliederversammlung des Unterbezirks Göttingen der SPD vorgetragen worden. So werde ich mich nur noch auf das konzentrieren, was nach meiner Einschätzung noch nicht genannt wurde. Und ich füge meinen Ausführungen einen kurzen Nachtrag zum Sonderparteitag der SPD vom 21. Januar 2018 an.
Ein historisches Trauma holt die SPD aktuell wieder ein: der Vorwurf, sich der „Staatsräson“ zu entziehen, wenn sie nicht zu einer Koalitionsbildung mit den Unionsparteien bereit sei. Die SPD müsse Parteiinteressen „staatspolitischer Verantwortung“ unterordnen – jetzt, wo „Jamaika“ gescheitert sei. Instabilität drohe, gerade jetzt, weil auch sieben Parteien – so viele wie seit den fünfziger Jahren oder seit „Weimar“ nicht mehr – im Bundestag vertreten sind. Darunter mit der AfD eine radikal bis extrem rechte Partei. Drohen hier nicht „Weimarer Verhältnisse“, wie sie aus den Reihen der Unionsparteien, aber auch der FDP und in Medien beschworen werden?
Woher rührt dieses Trauma? Es führt uns in das Jahr 1930 zurück. Die SPD ließ damals im März des Jahres eine große Koalition mit der Zentrumspartei, der Deutschen Volkspartei und der Deutschen Demokratischen Partei scheitern. Anlass dafür war der Konflikt um die notwendige Neuordnung der Arbeitslosenversicherung, die angesichts der steigenden Arbeitslosenzahlen einen höheren Zuschuss vom Staat benötigt hätte. Bei den Neuwahlen im September 1930 reüssierte dann die Splitterpartei NSDAP zur zweit stärkste Partei. Der Vorwurf an die SPD war damals und bis heute, sie hätte sich eben der „staatspolitischen Verantwortung“ entzogen und dem Nationalsozialismus zum Durchbruch verholfen. Bewusst oder unbewusst wird dieses Trauma durch die Unionsparteien und Medien reaktiviert. Quo Vadis?
Mein Kollege von der Philipps-Universität Marburg, der Historiker Eckart Conze, warnte jüngst in einem Beitrag in der Zeitung „Die Zeit“ davor, Parallelen zu 1930 zu ziehen, weil diese zum einen unterschlagen, dass der Bruch der damaligen Koalition von langer Hand geplant war, und zwar nicht von der SPD, sondern von rechten politischen Kräften und zum anderen, weil wir uns in einer historisch anderen Situation befinden: die Demokratie ist im Vergleich stabiler. Dennoch ist spürbar, dass dieses Trauma oder auch Ressentiment – wie auch der Vorwurf der sog. Vaterlandsverräter – gegen die Sozialdemokratie, selbst nach fast 80 Jahren in der Gesellschaft und in der SPD noch wirkt. Es hängt eng mit dem Zivilisationsbruch durch den Holocaust im Nationalsozialismus zusammen.
Der Verweis auf „Weimarer Verhältnisse“ zieht also noch und ist wirkmächtig, er hat sich in das historische Gedächtnis der SPD eingeschrieben. Aber der Verweis auf die die „staatpolitische Verantwortung“ hat kein Fundament mehr, da die politische Gesellschaft keine Gesellschaft von Antidemokrat_innen mehr ist.
Und dennoch können wir aus den Weimarer Erfahrungen lernen – oder sollten es zumindest – wie auch Eckart Conze meint: nämlich, dass große soziale Verwerfungen wie in der damaligen Zeit, die mit einer – wie Conze es nennt – „fundamentalen gesellschaftlichen und kulturellen Verunsicherungen“ einhergingen und durch politische Fehlentscheidungen Demokratien in Europa zusammenbrechen ließen, nicht unterschätzt werden dürfen.
Wir diskutieren in den Sozialwissenschaften schon seit einigen Jahren, dass wir uns wieder in einer sog. großen Transformation befinden, die vergleichbar ist mit der großen Transformation im Übergang zum 19. Jahrhundert – dem beginnenden Siegeszug des Kapitalismus und der Industrialisierung. Heute sprechen wir von der Finanzialisierung des Kapitalismus, von Globalisierung und Digitalisierung und in Deutschland vom Ende des rheinischen Kapitalismus. Es ist eine Transformation, die in den 1970er Jahren begann und durch einen zum Teil aggressiven Neoliberalismus – zunächst in den USA, im United Kingdom, in Lateinamerika (Chile) oder Spanien unter Franco – ihren Ausgang nahm. Der soziale Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit durch den Ausbau von Sozialstaaten wurde dabei aufgekündigt. Seitdem droht sich die Vorstellung von einer Marktgerechtigkeit als ein gesellschaftliches Ordnungsprinzip mehr und mehr vor Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit zu schieben.
Die große Transformation, die wir erleben, ist keine Naturgewalt, die über die Gesellschaften kommt, sie ist in der Weise, in der sie verläuft, ein Ergebnis politischer Entscheidungen – Entscheidungen nicht etwa nur von konservativen Regierungen, sondern eben auch durch die Demokraten in den USA, durch New Labour in U.K. in den 1990er Jahren und leider auch durch die von der SPD geführte Regierung ab 2003 – ab der Agenda 2010.
Alles das führt wieder in fundamentale gesellschaftliche und kulturelle Verunsicherungen – und es sind nicht nur gefühlte, sondern sehr reale soziale Unsicherheiten, die hier zum Ausdruck kommen. Zugleich nimmt die soziale Ungleichheit in fast allen Gesellschaften zum Teil dramatisch zu – so auch in Deutschland.
Franz Walter ist vor gut drei Wochen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) mit der organisierten Sozialdemokratie und damit auch mit der SPD scharf ins Gericht gegangen, und ich finde zurecht. Man könnte es so zusammenfassen: 1998 hat die SPD den Wärmestrom versprochen – und zunächst war der Regierungswechsel auch erst einmal eine Befreiung, er brachte wieder das Gefühl von Freiheit. Aber im Bündnis mit den Grünen und mit der Agenda 2010 hat sie dann den Kältestrom des Neoliberalismus zum Durchbruch verholfen. Ein progressiver Neoliberalismus löste so letztlich 16 Jahre Neokonservatismus oder regressiven Neoliberalismus (Deregulierung kombiniert mit Nationalismus, „Leitkultur“ und traditionellen Vorstellungen von Familie) ab und wurde zum politischen Programm.
Hierzu Franz Walter:
„Die Oberschicht lebte in den Nullerjahren wie schon zuvor, aber nun zusammen mit dem wohlsaturierten grün-postmateriellen Milieu, in kommoder Zufriedenheit mit den obwaltenden Umständen. In den prekären Mittelagen und den unteren Schichten, die die SPD über hundert Jahre hinweg als Herz und Seele ihrer Weltanschauung und Organisation begriffen hatten, war das Missvergnügen über die nunmehr als unzureichend empfundenen materiellen Verhältnissemit mit Händen zu greifen“.
Eigentlich wäre es nun das Zeitalter sozialdemokratischer Politik, um in das neoliberale Marktgeschehen einzugreifen und – um es mit Oskar Negt zu sagen – dem „Kältestrom“ des Neoliberalismus den „Wärmestrom“ einer sozialen Demokratie entgegenzustellen.
Trotz einiger Korrekturen an der Agenda 2010 in den beiden letzten großen Koalitionen – und es finden sich noch weitere im Sondierungspapier – hat die SPD aber bisher keine Idee davon entwickelt, was heute soziale Gerechtigkeit sein könnte, was überhaupt soziale Demokratie noch heißt. Das zeigte sich im Wahlprogramm und dem Bundestagswahlkampf, und das zeigt sich nun auch in den Sondierungsergebnissen.
Das Sondierungspapier ist in weiten Teilen bereits so detailliert ausgearbeitet – bis hin zur Finanzierung von Maßnahmen und konkreten gesetzlichen Vorhaben, dass es eigentlich kein Papier mehr ist, in dem Ergebnisse einer Sondierung festgehalten sind. Es hat über Strecken bereits die Qualität eines Koalitionsvertrags. Insofern hat Andrea Nahles Recht, wenn sie sagt, es könne nicht mehr nachverhandelt werden.
Besonders irritierend ist in dem Papier, dass…
- …Fragen der Gerechtigkeit ausschließlich europäischer Politik zugeschrieben werden, als gebe es keine innenpolitischen, sozialstaatlichen Handlungsmöglichkeiten (mehr). Dabei gehört sozialstaatliche Politik zu den Politikfeldern, die am wenigsten einer europäischen Vergemeinschaftung unterliegen.
- …arbeitsmarktpolitische, bildungs- und familienpolitische Interventionen rein finanzieller Natur sind, aber keinerlei Interventionen in das Marktgeschehen thematisiert werden. Gemeint ist: es werden finanzielle und infrastrukturelle Anreize geschaffen, aber jede/jeder hat selbst dafür zu sorgen, mit neuen Anforderungen am Arbeitsmarkt, der Globalisierung und Digitalisierung umzugehen. Es ist kein Gestaltungswille mit Blick auf Digitalisierung und Globalisierung sowie Mitbestimmung in der Wirtschaft erkennbar. Stattdessen wird die neoliberale Doktrin des Fördern und Forderns bemüht. Soziale Risiken durch die gegenwärtigen Entwicklungen werden in ihrer Verantwortung individualisiert.
- …beim Thema Flucht und Asyl das Ergebnis das Potenzial in sich trägt, Völkerrecht zur brechen: die Genfer Flüchtlingskonvention, die UN-Menschenrechtscharter sowie die UN-Kinderrechtscharter. Paradoxerweise sollen gleichzeitig Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden.
Was folgt nun daraus?
Statt sich einer vermeintlichen „Staatsräson“ zu unterwerfen, muss die SPD sich damit auseinandersetzen, was ihre Vorstellungen von einer gerechten Gesellschaft sind. Sie muss sich den gesellschaftlichen und kulturellen Verunsicherungen annehmen. Dies wäre ihre zentrale gesellschaftspolitische Verantwortung.
Und das hieße dann auch, in Konfrontation zu einer merkelisierten, entleerten CDU, einer populistisch-konservativen, einer nach rechts ausgreifenden CSU und einer marktradikalen FDP zu gehen. Zu diesen muss es eine Alternative geben. Es geht um eine (Re-)Demokratisierung der Demokratie und Ökonomie, es geht um soziale Freiheit und eine „soziale Heimat“, die – sozialdemokratisch gedacht – universal ist.
Werden aber stattdessen jetzt Koalitionsverhandlungen auf der Grundlage der Sondierungsergebnisse geführt, obsiegt ein Neokonservatismus mit progressiven Einsprengseln. Oder wie es ein Kommentator in der Süddeutschen Zeitung jüngst sinngemäß formulierte: die Gesellschaft wird an die Wand gefahren, mit der SPD nur langsamer.
Bietet die SPD hier keine Alternative, macht sie sich historisch überflüssig. Eine solche Alternative kann nur im Konflikt und in Konfrontation mit Konservativen und Marktradikalen zum Ausdruck gebracht werden und nicht in Kollaboration, sprich: in einer großen Koalition.
-.-.-
Nachtrag zum Votum des Sonderparteitags der SPD am 21. Januar 2018:
Der Sonderparteitag hat mit 56 Prozent Koalitionsverhandlungen zugestimmt. Es ist ein sehr knappes Ergebnis, das zudem an einige grundlegende Nachverhandlungen gebunden ist. Die SPD geht mit diesem Ergebnis geschwächt in Koalitionsverhandlungen. Jedoch wird das knappe Ergebnis auch die Unionsparteien unter Druck setzen. Sie müssen der SPD entgegen kommen, um eine gemeinsame Regierungsbildung zu ermöglichen. Der Ausgang der Mitgliederbefragung über eine Groko ist unsicherer denn je.
Aber dies ist nur die eine, vordergründige Seite der gegenwärtigen Situation der SPD. Die andere Seite spiegelt sich im Verhältnis zwischen den Mitgliedern der Partei und ihrer Führung. Die SPD ist im engeren Sinn nicht gespalten; es gibt vielmehr eine Entfremdung zwischen Parteimitgliedern und Parteiführung. Ablehner_innen aber zugleich auch viele Befürworter_innen von Koalitionsverhandlungen eint, dass sie solchen äußerst skeptisch gegenüber stehen. Argumente für oder gegen Koalitionsverhandlungen sind in den diversen regionalen SPD-Versammlungen differenziert vorgetragen, aber augenscheinlich nur bedingt ernst genommen worden. Entrückt davon haben Verhandlungsführer_innen teilweise in brachialer Weise gegen Skeptiker_inn argumentiert oder die Ergebnisse der Sondierungsgespräche derart gehypt, als trügen diese eine klare sozialdemokratische Handschrift. Aber dies tun sie nicht.